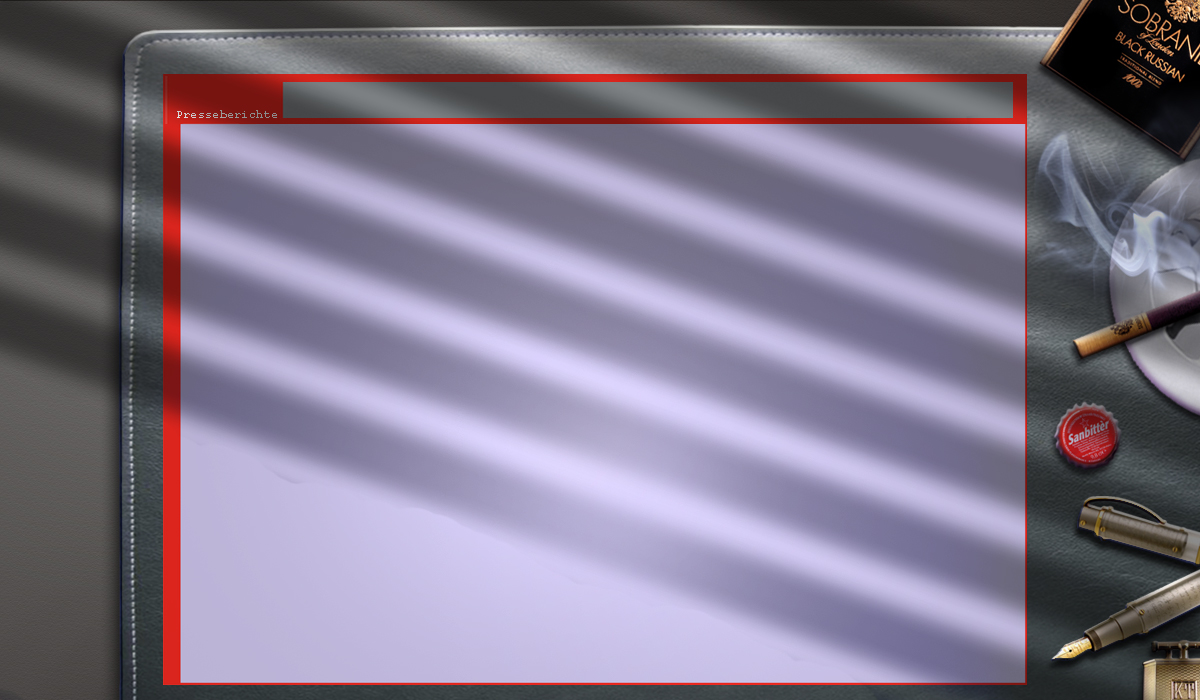
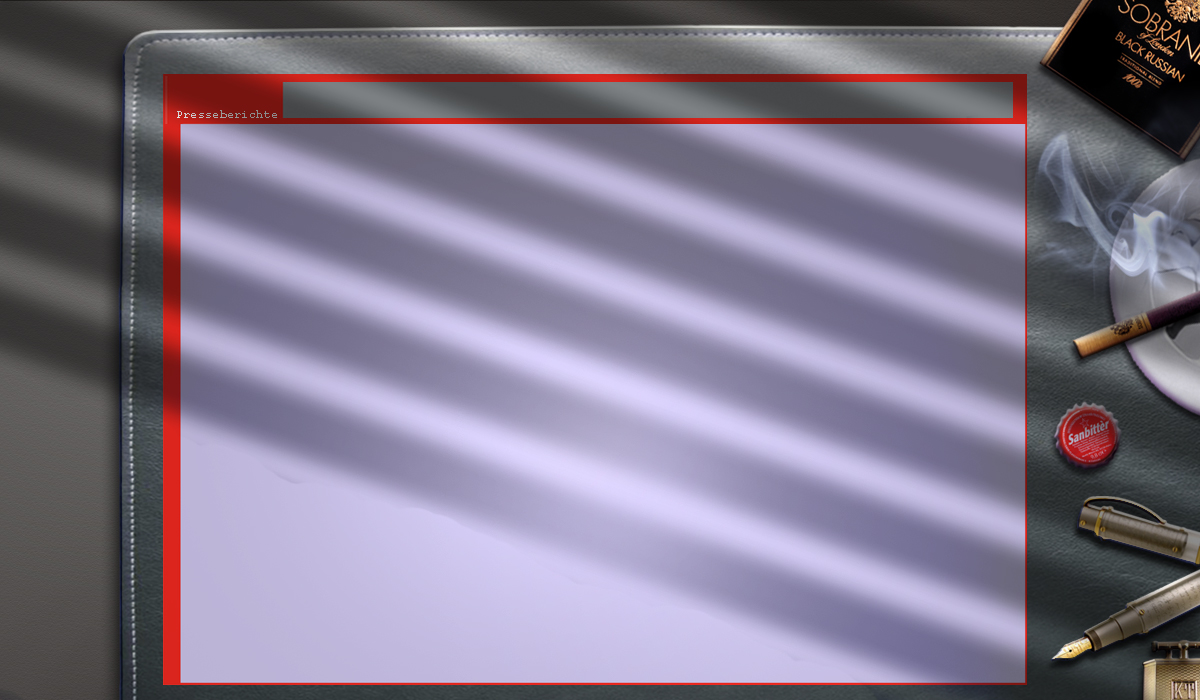
| Themenübersicht: |
| Saddams Helfer kehrt zurück |
||
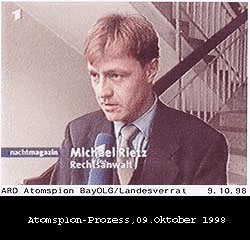 |
||
| Spezialist für Uran-Anreicherung stellt sich deutscher Justiz Angeblichem "Superhirn" des irakischen Automprogramms droht Prozeß wegen Landesverrats - Von Hans Leyendecker Im Untersuchungsgefängnis der Bundespolizei in Rio de Janeiro waren Spezialisten der Wiener Internationalen Atomenergiebehörde zu Besuch. Sie wollten von dem aus Kaufbeuren stammenden Techniker Karl-Heinz Schaab mehr über das geheime Atomprogramm Saddam Husseins erfahren. Der unscheinbare Mann aus dem Allgäu, der im Dezember 1996 von Zielfahndern des Bundeskriminalamts in seinem brasilianischen Versteck aufgespürt worden war, gilt den Vereinten Nationen als ein führender Kopf des irakischen nuklearen Waffenprogramms. Novum in der Rechtsgeschichte Allerdings machte der heute 46jährige Schaab nur karge Angaben. Enttäuscht reisten die Wiener wieder ab. Schaab, der unter den Helfern des irakischen Diktators Saddam Hussein der mastermind gewesen sein soll, will jetzt sein Schweigen brechen. Am Donnerstag kehrte er aus Sao Paulo zurück und stellte sich den Behörden. Am Freitag wurde er den Richtern des 3. Strafschutzsenats beim Münchener Oberlandesgericht vorgeführt. Die Bundesanwaltschaft will ihm wegen Landesverrats den Prozeß machen. Ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte. Bislang ist eine solche Anklage nur gegen Agenten erhoben worden, die für eine fremde Macht spioniert haben. Die Höchststrafe ist lebenslänglich. Durch Schaabs Aktivitäten, so die Bundesanwälte, stünden die Deutschen Weltweit am Pranger. Sie müßten "Nachteile im Bündnissystem fürchten" und auch die negative "öffentliche Meinung der Staatengemeinschaft". Hinter den Kulissen haben Bundesanwalt Joachim Lampe und Schaabs Rechtsvertreter Michael Rietz erste Gespräche geführt. Lampe wird nur dann gnädig sein, wenn der Techniker aus dem Allgäu redet. Schaabs erste Reuebekundungen wie: "Ich habe mich schuldig gemacht", werden Lampe nicht reichen. Schon gar nicht, weil die Bundesanwaltschaft auch Spuren Schaabs gefunden hat, die in Iran führen. Wenn der gelernte Modellbauer Schaab jetzt auspacken sollte, würde er große Politik machen. Schaab war Spezialist für die Anreicherung von Uran mit Hilfe der Gasultrazentrifugentechnik (GUZ). Die GUZ ist eine Erfindung deutscher Ingenieurkunst. In solchen technischen sehr komplizierten Anlagen ist Hochanreicherung von Uran 235 möglich. Know-How und ein großer Teil der nach dem Golfkrieg im Irak entdeckten GUZ stammten nach Meinung der Irak-Inspektoren aus Deutschland. Ebenso kamen nahezu alle Fertigungsteile für die Zentrifugenteile sowie der überwiegende Teil der Zulieferungen aus der Bundesrepublik. Ein aus Aachen stammender deutscher UN-Inspektor gab zu Protokoll, daß seine irakischen Gesprächspartner Schaab "als Schlüsselfigur für die Entwicklung der irakischen GUZ" bezeichnet hätten. Kiloweise belastendes Material war auf einer Geflügelfarm südlich von Bagdad gefunden worden. In Containern steckten streng geheime Zeichnungen zur GUZ, und einige von ihnen trugen den Aufdruck MAN. Die MAN-Technologie ist Spezialist für Gasultrazentrifugen und hat 1979 auf dem Gelände der Uran-Anreicherungsanlage im westlichen Gronau ein Montagewerk für Zentrifugen errichtet. Von September 1970 bis Ende 1981 hatte auch Schaab bei MAN an der GUZ gearbeitet. Jahre später hatte ein Dietrich Hintze aus dem Münsterland, damals Miteigentümer der in das irakische Netzwerk eingebundenen Maschinenfabrik H+H Metalforum, den Techniker Schaab mit Abgesandten Bagdads in Verbindung gebracht. Schaab war mittlerweile Chef der Kaufbeurer ROSCH Verbundwerkstoffe GmbH, und der Spezialist für gewickelte Rohre wurde zum hochbegehrten Gesprächspartner der Iraker. Mehrfach reiste er wegen der GUZ in den Irak. Als die Bundesanwaltschaft nach ihm fahndete, versteckte er sich in Brasilien, bis das BKA ihn aufspürte. Bislang hat er in Brasilien nur zwei einschlägig bekannte deutsche Spezialisten, ehemalige MAN-Mitarbeiter, belastet. Beide sind tot. Etwas düster hat Schaab im Spiegel geraunt, daß man "auch mal über die Rolle von MAN sprechen" müsse. Mit der Sicherheit sei es nicht weit her gewesen. Streng geheime Pläne hätten offen herumgelegen. Auch seien noch andere deutsche Experten verstrickt. Ein heikler juristischer, politischer aber auch ein tragischer Fall: Nach rund 15 Monaten Auslieferungshaft war Schaab zunächst Anfang 1998 freigekommen, weil die Brasilianer ihn wegen einer politischen Tat nicht ausliefern wollten. Er lebte in einem Dorf irgendwo zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo. Urinfeuchte Zelle Weil das Geld ausging, die Mutter todkrank ist und seine Frau Blasenkrebs hat, kehrte er jetzt zurück. Da er so erschöpft war, mußte am Freitag vor dem Staatsschutzsenat sein Anwalt die schrecklichen Haftbedingungen in Rio schildern. Die zwölf Quadratmeter große urinfeuchte Zelle habe sich Schaab manchmal mit elf Gefangenen geteilt. Das Gefängnis Landsberg am Lech, in das ihn jetzt die Richter einwiesen, ist vergleichsweise ein Paradies. Die Schilderung der miesen Haftbedingungen zahlt sich in der Regel aus. Strafen, die in Brasilien verbüßt wurden, werden in Deutschland mit dem zwei- bis zweieinhalbfachen Satz mildernd angerechnet. Schaab war 15 Monate in Auslieferungshaft. Wenn er redet und das Strafmaß bei fünfeinhalb Jahren liegen sollte, müßte er nach der Hauptverhandlung nicht mehr ins Gefängnis. Samstag/Sonntag, 26./27. September 1998 THEMEN AUS DEM AUSLAND Süddeutsche Zeitung Nr. 222 |